Albit
Na[AlSi3O8]

Albit (Tuftane, Iveland/ Norwegen) © Sammlung Institut f. Geologische Wissenschaften, FU Berlin
Bestimmungsmerkmale
| Farbe | weiß, grau, grüngrau, blaugrau |
| Glanz | glasig |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Spaltbarkeit | sehr gut nach (001), gut nach (010) |
| Bruch | uneben |
| Härte | 6 - 6,5 |
| Tenazität | spröde |
| Strich | weiß |
| Dichte | 2,61-2,63 |
| Löslichkeit | säureunlöslich |
Kristallographische Daten
| Kristallsystem | triklin |
| Kristallklasse | 1' |
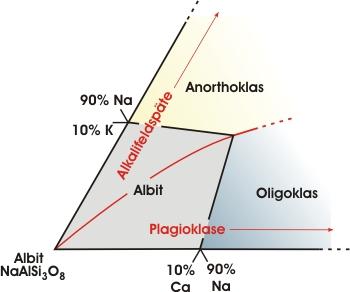
Albit als Endglied und Mischkristall
Zur Chemie von Albit
Albit gehört sowohl zu den Alkalifeldspäten als auch zu den Plagioklasen. Neben dem reinen Endglied NaAlSi3O8kann Albit bis zu 0,1 p.f.u. an K und Ca aufnehmen (siehe Grafik). Darüber hinaus können Ionen von Ba, Ti, Fe2+, Fe3+, Mg, Sr und Mn im Albit in Spuren eingebaut sein. Zu Umwandlungen kommt es besonders innerhalb der Feldspat-Reihen durch Entmischung, Transformation und Rekristallisation.
Kristallographische Angaben zu Albit
Tracht: Prismen, Tafeln
Habitus: körnige und dichte Aggregate
Zwillinge: sehr häufig polysynthetisch nach Albit-Gesetz
Einheitszelle: a=8,16Å b=12,87Å c=7,11Åa=93,45°;b=116,4°;g=90,28°;
Albit im Mikroskop
Farbe im Hellfeld: farblos
Interferenzfarbe: grau bis gelb 1. Ordnung
optischer Charakter: 2+
Relief: niedrig (n=1,53-1,54)
Doppelbrechung: 0,01
Wo kommt der Name des Minerals her?
Der Name Albit ist von lat. albus (weiß) abgeleitet.
Wo kommt das Mineral vor?
Albit kommt als weit verbreitetes gesteinsbildendes Mineral in sauren bis basischen Magmatiten sowie in Metamorphiten (z.B. in Grünschiefern) vor, selten sedimentär (in Arkosen) oder hydrothermal in Erzgängen.
Schlagwörter
- Albit, Bestimmungsmerkmal